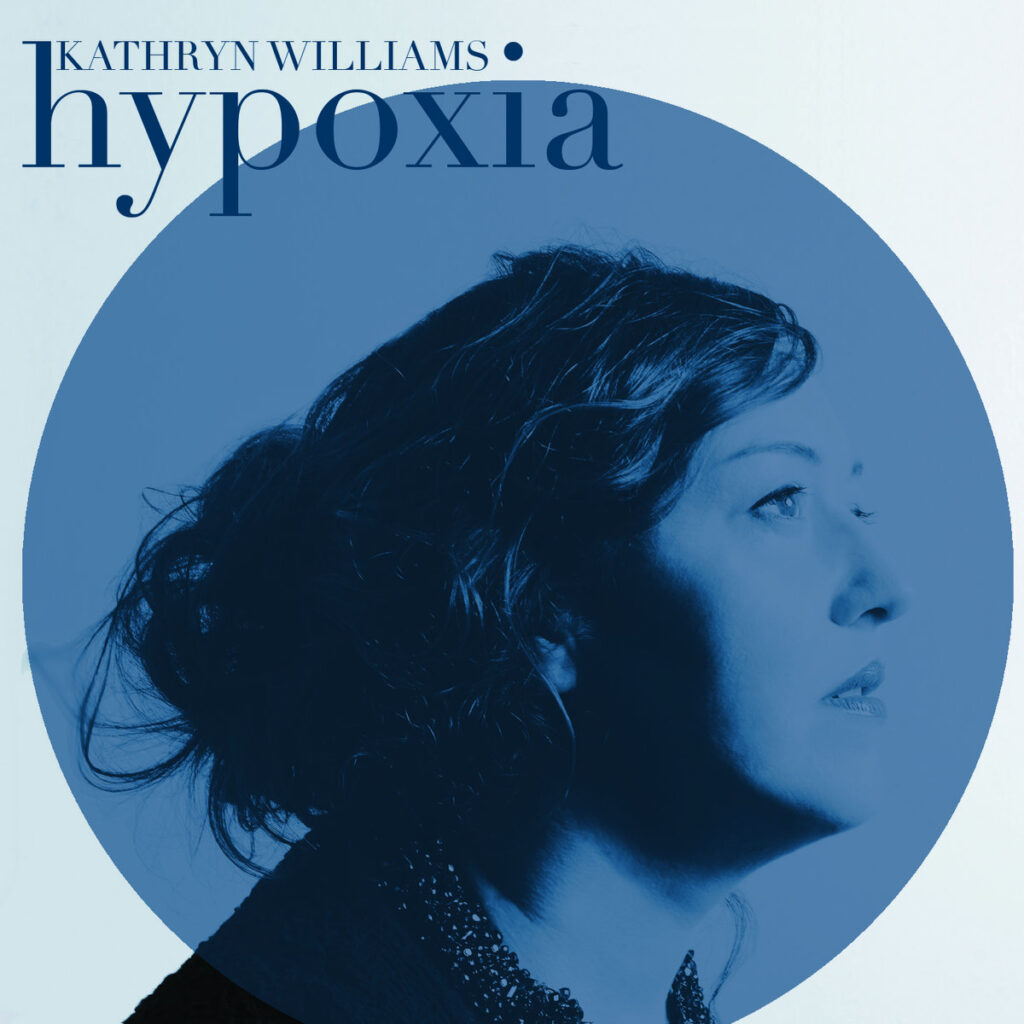Zarte Wucht, live im Kreis: Wie ANNA TIVEL auf ANIMAL POEM poetischen Folk, Jazz-Schattierungen und dokumentarische Beobachtung zu einer ungeschönten, menschenfreundlichen Bestandsaufnahme verdichtet.
Mit „Animal Poem“ zieht Anna Tivel die Fokusebene so nah heran, dass die Lieder atmen: man hört Fingersqueaks, den staubigen Atem der Becken, sogar das Bellen eines Hundes. Die Entscheidung, „live in a circle“ mit Freundinnen und Freunden aufzunehmen, war programmatisch. Sam Weber – Co-Produzent, Engineer, Gitarrist – richtet Mikrofone aus, schlüpft zurück an die Saiten, lässt sein Spiel im Ensemble verschwinden. Das Ergebnis schmiegt sich an Tivel’s Stärke, Geschichten in feinsten Nuancen zu zeichnen. Seit „Small Believer“ und „The Question“ stand sie für Porträts am Rand der Gesellschaft, „Outsiders“ und „Living Thing“ öffneten das Klangbild ins Bandhafte. „Animal Poem“ bündelt diese Linien, reduziert die Studiogeste, verstärkt das Zuhören.
Der Auftakt „Holy Equation“ setzt die Tonalität: städtische Alltagsfragmente, ein schieflaufendes Mathebild, Saxophonlinien, die wie ein Zeuge torkeln. „This whole thing is really a hopeless equation“, singt Tivel – später bittet sie „God bless my neighbor“, ohne Pathos, mit genauer Blickführung. Der Titelsong zeichnet eine erschöpfte Mutter mit Pappschild, die ihrer Tochter die Welt erklärt: „You can be someone who loves, or you can be somebody else.“ Solche Sätze tragen, weil die Band Luft lässt: gedämpfte Drums, aufgeraute Gitarren, ein Tastenakkord wie eine Hand auf der Schulter. „Hough Ave, 1966“ verwebt Erinnerung und Protestgeschichte, erinnert an Cleveland und an Nina Simone: „Don’t let me be misunderstood“ als Radiolicht im Taxi, Bass und Stimme halten die Spannung.
In „Badlands“ stapfen Drums und Keys durch Sandsteinbilder, während „White Goose“ aus einer Kindheitswunde ökologisches Trauern formt. „Meantime“ spannt die Brücke zwischen Gewaltspur und Liebesversprechen: „I’m gonna love you, in the meantime, til the gold light ends“ – musikalisch knochig, emotional klar. „Airplane to Nowhere“ funkelt mit Nightclub-Schimmer, verliert sich jedoch streckenweise im Schweben; „Paradise (Is in the Mind)“ besitzt Zug, doch das Refrainmantra bleibt breit. Finale Ruhe bringt „The Humming“: „What if that bright humming is all there ever was?“ – eine Frage, die nicht schließt, sondern offen hält. Das Cover bekräftigt diesen Wahrnehmungsmodus: ein schwarzweißes Hangstück, Pfade, Geröll, eine kleine menschliche Figur, kaum mehr als eine Geste. Kein Symbolüberbau, eher Geografie des Suchens.
Wie die Songs kartiert das Bild Terrain, in dem man sich bewegt, tastend, mit Blick für Bruchkanten. Tivel spricht im Begleittext von Sterblichkeit, Verbindung, Bedeutung. Ihr Satz „Humanity is unfolding as we describe it… the attempt is everything“ legt die poetische Ethik frei: beobachten, benennen, scheitern, erneut versuchen. Zwischen den Zeilen wirkt Weber als stiller Kurator – das Ensemble hört zu, bevor es spielt. „Animal Poem“ besitzt große Momente in Intimität und Sprache, riskiert jedoch leichte Gleichförmigkeit durch den permanenten Leisepegel. Die spontanen Sax- und Noise-Schimmer öffnen Räume, doch nicht jede Spur findet eine zwingende Form.
Gerade diese kleine Unordnung – „messy and alive“ – macht das Album wahrhaftig, auch wenn es dramaturgisch nicht durchgehend zündet. Anna Tivel bleibt eine Erzählerin von Wärme und Klarheit, hält Distanz zu Kitsch, vertraut dem Wort, dem Atem, der Pause.
Transparenzhinweis: Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du über diese Links kaufst, erhält MariaStacks als JPC/Amazon-Partner eine kleine Provision. Für dich bleibt der Preis gleich.