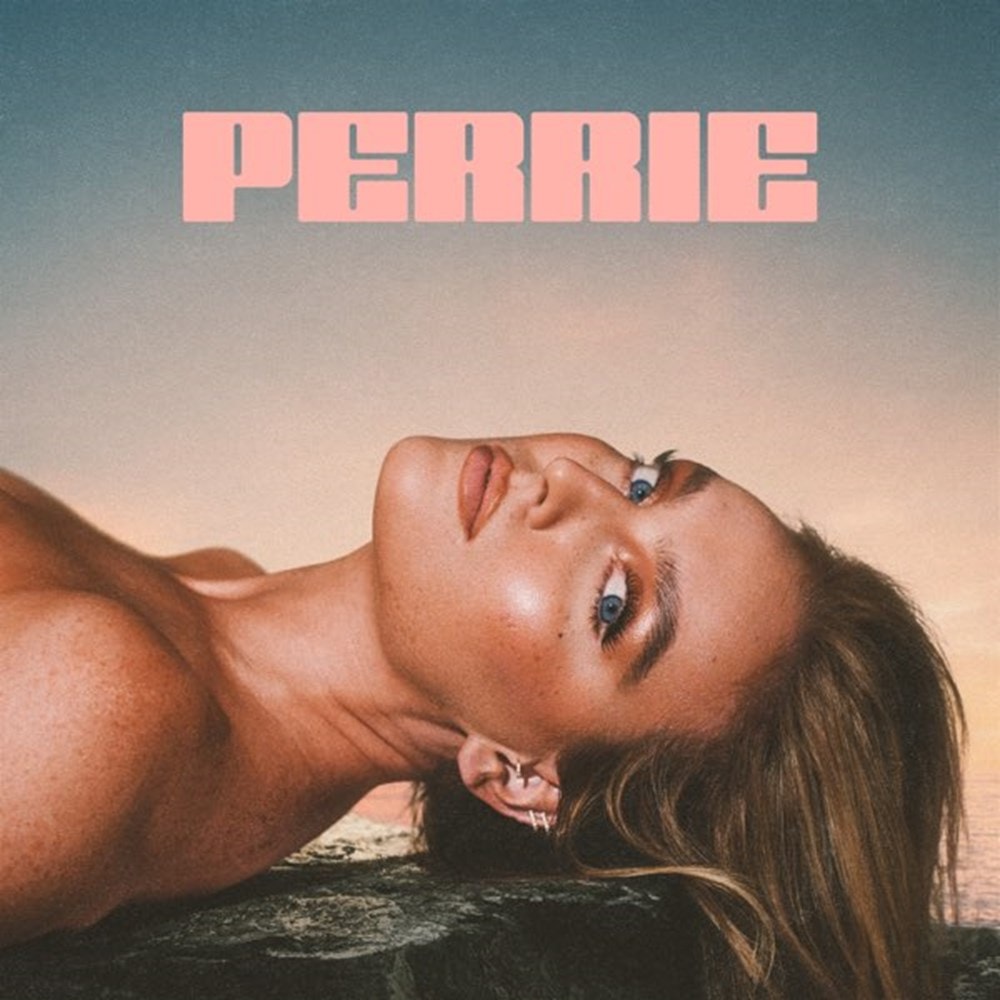Zwischen Märchen und Mechanik, zwischen Bläserchor und Basslinie entfaltet sich auf YELLOW SUBMARINE ein letztes Leuchten der BEATLES, das Kinderspiel und kompositorische Ordnung in ein merkwürdig heiteres Klangtheater verwandelt, halb Traum, halb Abschied aus einer Welt, die sich gerade selbst neu erfindet.
Man hört diese Langspielplatte in einem Winter, der nach Kohleöfen und Veränderung riecht. „Yellow Submarine“ läuft auf dem Plattenteller, und die Stimmen der vier jungen Männer aus Liverpool wirken zugleich vertraut und fremd geworden. Es ist, als ob sie sich selbst aus einer anderen Zeit herüberrufen: eine Vokalgruppe, die längst über das reine Liedformat hinausgewachsen ist, nun aber noch einmal in die Rolle des Geschichtenerzählers schlüpft. Auf der ersten Seite dieser Platte liegen Spuren von Albernheit neben einem Rest tiefer Melancholie. Ringo Starr singt die Titelmelodie mit der gutmütigen Einfachheit eines Jahrmarktsängers, doch dahinter schimmert eine Ahnung von Einsamkeit, die jedes Lachen fragil erscheinen lässt. „Only a Northern Song“ öffnet die Tür zu einer anderen Sphäre: Hier erklingt die Orgel nicht mehr als Begleitung, sondern als Kommentar, das Schlagzeug zittert, die Trompeten wirken wie Signale aus einem Labyrinth der Selbstironie.
„All Together Now“ ist beinahe eine Kinderlied-Parodie, schlicht, aber bewusst übersteigert, während „Hey Bulldog“ in seiner Schwere und rhythmischen Wucht die letzte echte Spannung dieses Albums entfaltet. Hier werden Klang und Bewegung zu einem einzigen Körper, der sich in die Mikrofone wirft, als müsse er gegen das eigene Ende ansingen. George Harrison lässt in „It’s All Too Much“ die Töne zu flimmernden Flächen werden, eine Übersteigerung, die den Traum vom großen Freiheitsklang bereits in sich selbst erschöpft. Den Abschluss bildet „All You Need Is Love“, ein Satz, der in diesen Tagen zwischen Notstandsgesetzen und nächtlichen Demonstrationen zugleich naiv und notwendig klingt. Die zweite Seite, die George Martin den Beatles gewissermaßen entreißt, wirkt wie ein Blick hinter die Kulissen des Märchens.
Seine orchestralen Stücke – „Pepperland“, „Sea of Time“, „March of the Meanies“ – verbinden formale Disziplin mit der Ahnung eines neuen musikalischen Theaters. Hier verschmelzen Harfen, Bläser und Violinen zu Tableaus, in denen man mehr sieht als hört. Man spürt den Versuch, die populäre Melodie in die Sphäre der orchestralen Form zu überführen. Dieses Wechselspiel zwischen Ironie und Ernst, zwischen Studioexperiment und Orchesterdisziplin, zwischen Kindertraum und kalkulierter Klangphantasie, macht „Yellow Submarine“ zu einem merkwürdigen Übergangswerk. Es ist nicht das stärkste, vielleicht aber das aufschlussreichste Zeugnis dafür, dass die Beatles sich auf einem schmalen Grat zwischen Unterhaltung und Kunst bewegen – in einer Zeit, in der beides noch um sein Gleichgewicht ringt.
Transparenzhinweis: Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du über diese Links kaufst, erhält MariaStacks als JPC/Amazon-Partner eine kleine Provision. Für dich bleibt der Preis gleich.